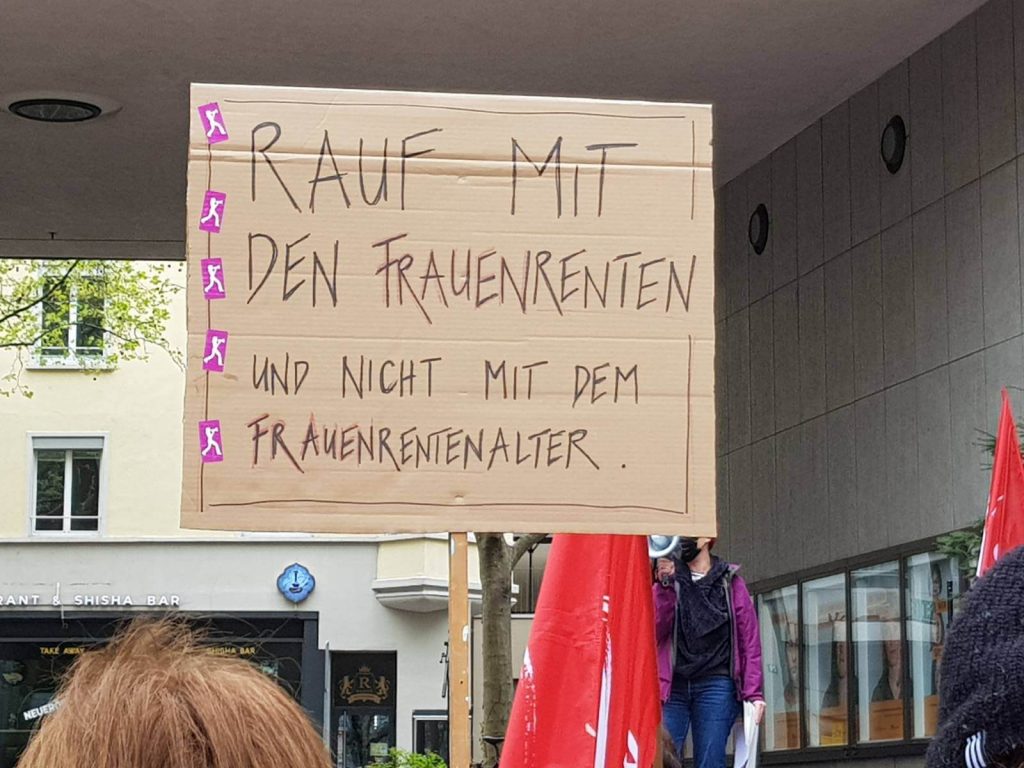Flugblatt zur Spitalbett-Aktion am 1. Mai in Zürich
«Wir mussten die Türen schliessen, damit wir die Betreuten nicht mehr schreien hörten» sagt die Pflegerin aus dem städtischen Pflegezentrum. «Ich habe sie über Stunden in ihrem Dreck liegen lassen müssen. Menschen, die ich seit Jahren kenne. Wir sind nur noch gerannt.» In den Altersheimen und die Pflegezentren war die erste Welle dramatisch und die zweite nur wenig besser. Notstand ist eine zu gemässigte Beschreibung für diese Arbeit, die schon vor der Pandemie auslaugte und wenig befriedigend war. Spardruck, Personalmangel, Mangel an qualifiziertem Personal. «Wir alle überlegen uns, aufzuhören. Wirklich alle.»
Spitalbetten ohne Personal sind nur Möbel.
Ganz anders und doch gleich ist die Situation in den Spitälern. Da sassen einige Abteilungen während des Lockdowns arbeitslos rum und die Intensivstationen arbeiteten auf Hochtouren, verlangten einen zerstörerischen Einsatz von ihren Pflegenden und Ärzt_innen. «Seit sie gemerkt haben, dass der Bund für die verschobenen Operationen nicht aufkommt, läuft die Koordination der Corona-Fälle super. Sie sind vor allem daran interessiert, die elektiven Eingriffe so lange wie möglich weiterzufahren», sagt eine Pflegerin einer Intensivstation.
Nicht der Notstand hat zur Veränderung geführt, sondern der wirtschaftliche Zwang, so viel wie möglich zu operieren und das Defizit aus der ersten Welle abzuarbeiten. Für die Intensivstationen bedeutete das eine gewisse Entspannung verglichen mit der Situation während des Lockdowns, für alle anderen eine Rückkehr ins Arbeitsleben unter Hockdruck. Eine weitere Intensivierung der Arbeit und weitere Pflegende, die den Absprung planen.
Hauptsache Profit
Ein Spital, auch ein staatliches, ist eine Firma, die Profit machen muss, um nicht unterzugehen. André Zemp befiehlt simpel: «Spitäler brauchen Gewinne» und Natalie Rickli meint: «Wir richten die Spitalplanung auf den Normalzustand aus. Unsere Spitallandschaft ist im Normalfall auf Wettbewerb ausgerichtet. Das ist gut so uns soll so bleiben.» Aus der Pandemie lernen ist nicht ihr Fall. Auch der lausige Gegenvorschlag zur Pfleginitiative zeigt, dass keine Verbesserung geplant ist.
Ermöglicht wird Wettbewerb durch die DRG oder Fallkostenpauschalen: Ein Fall, also eine Behandlung, wird pauschal bezahlt. Wenn er speditiv behandelt wird, macht das Spital Plus, wenn sich ein_e Patient_in erdreistet Komplikationen zu haben, bedeutet das hingegen Minus. Und schon stehen alle Spitäler zueinander in Konkurrenz, denn die Pauschalen werden alle vier Jahre verglichen und nach unten angepasst. Der Spardruck ist Programm.
Kapitalismus macht krank
Das führt nur rein theoretisch zu geringeren Kosten – das lebhafte Beispiel sind die USA, die schon seit Jahrzehnten Fallkostenpauschalen (DRGs) haben und auch das teuerste Gesundheitswesen der Welt – für die Armen ebenso das schlechteste. Was DRGs wirklich bedeuten, ist dass diejenigen, die ins Gesundheitswesen investieren, auch profitieren wollen, das geht am einfachsten mit Spitzenmedizin und am schlechtesten mit langwierigen Krankheiten von Allgemeinversicherten. Ganz anders wäre ein gerechtes Gesundheitswesen. Das bezahlt die Arbeit, die für eine angemessene Behandlung nötig ist, sogar im Fall von Komplikationen und sorgt dafür, dass das Personal qualitativ gute Arbeit leisten kann.
Deshalb müssen wir kämpfen. Für bessere Arbeitsbedingungen des Personals im Gesundheitswesen und bessere Behandlung für uns müssen wir selber sorgen.
Gesundheit statt Profit
FCK DRG!
Komm auch: Demo «Gesundheit statt Profit» am 26. Juni um 14 Uhr, Helvetiaplatz ZH