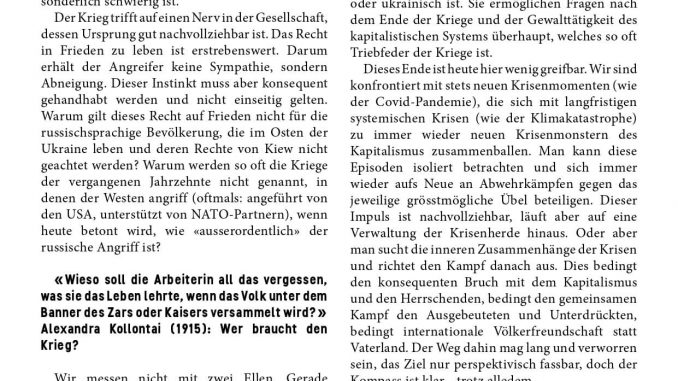
Krieg dem Krieg
Grundsätzlich: Weder die russische Staatsführung um Putin noch die ukrainische Regierung um Selenskyj sind linke Bezugspunkte. Darüber kann es keine Verwirrung geben. Das vergangene Jahr seit der Eskalation des Kriegs in der Ukraine lässt daran keine Zweifel. Messen wir die Herrschenden an ihren Taten (und nicht an ihren Worten) und messen wir sie daran, was diese Taten für das Volk bedeutet. Dann ist es nur logisch, sich weder für die Mächtigen in Moskau noch für jene in Kiew zu entscheiden. Eine einfache Feststellung, die nicht sonderlich schwierig ist.
Der Krieg trifft auf einen Nerv in der Gesellschaft, dessen Ursprung gut nachvollziehbar ist. Das Recht in Frieden zu leben ist erstrebenswert. Darum erhält der Angreifer keine Sympathie, sondern Abneigung. Dieser Instinkt muss aber konsequent gehandhabt werden und nicht einseitig gelten. Warum gilt dieses Recht auf Frieden nicht für die russischsprachige Bevölkerung, die im Osten der Ukraine leben und deren Rechte von Kiew nicht geachtet werden? Warum werden so oft die Kriege der vergangenen Jahrzehnte nicht genannt, in denen der Westen angriff (oftmals: angeführt von den USA, unterstützt von NATO-Partnern), wenn heute betont wird, wie «ausserordentlich» der russische Angriff ist?
«Wieso soll die Arbeiterin all das vergessen, was sie das Leben lehrte, wenn das Volk unter dem Banner des Zars oder Kaisers versammelt wird?», Alexandra Kollontai (1915): Wer braucht den Krieg?
Wir messen nicht mit zwei Ellen. Gerade aus den Weltregionen, die in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder Ziel westlicher Angriffe wurden, ertönen die lautesten und konsequentesten Rufe gegen diesen Krieg und seine Fortsetzung. Das gefällt den Kriegstreiber_innen nicht, weil es ihre Darstellung des Kriegs als Kampf zwischen «Barbarei» und «Zivilisation» ins Leere laufen lässt. Weil die Kritik aufzeigt, dass es andere Perspektiven auf diesen Krieg gibt, in der nicht einfach entweder Selenskyj, Biden und Von der Leyen oder eben Putin «gut» oder «böse» sind, sondern ein Weder-Noch angesichts dieser Alternativen denk- und machbar ist.
Dankbarerweise kommen diese Perspektiven zunehmend auch bei uns auf. Sie eröffnen den Blick über die falschen Gegenüberstellungen und vermeintlichen Sachzwänge hinaus, die uns hier von Scharfmacher_innen angeboten werden. Sie ermöglichen Fragen nach den Ursachen von Kriegen, die nicht in der Psychoanalyse von Herrschenden zu suchen sind, sondern in der Konkurrenz um Profite und Einflussgebiete weltweit gefunden werden. Sie schärfen den Blick dafür, wer den Preis für diese Kriege zahlt und welche Klasse dabei stets obenaus schwingt – unabhängig davon, ob deren Pass nun russisch oder ukrainisch ist. Sie ermöglichen Fragen nach dem Ende der Kriege und der Gewalttätigkeit des kapitalistischen Systems überhaupt, welches so oft Triebfeder der Kriege ist.
Dieses Ende ist heute hier wenig greifbar. Wir sind konfrontiert mit stets neuen Krisenmomenten (wie der Covid-Pandemie), die sich mit langfristigen systemischen Krisen (wie der Klimakatastrophe) zu immer wieder neuen Krisenmonstern des Kapitalismus zusammenballen. Man kann diese Episoden isoliert betrachten und sich immer wieder aufs Neue an Abwehrkämpfen gegen das jeweilige grösstmögliche Übel beteiligen. Dieser Impuls ist nachvollziehbar, läuft aber auf eine Verwaltung der Krisenherde hinaus. Oder aber man sucht die inneren Zusammenhänge der Krisen und richtet den Kampf danach aus. Dies bedingt den konsequenten Bruch mit dem Kapitalismus und den Herrschenden, bedingt den gemeinsamen Kampf den Ausgebeuteten und Unterdrückten, bedingt internationale Völkerfreundschaft statt Vaterland. Der Weg dahin mag lang und verworren sein, das Ziel nur perspektivisch fassbar, doch der Kompass ist klar – trotz alledem.
Kampf dem Kapital bis der Frieden siegt